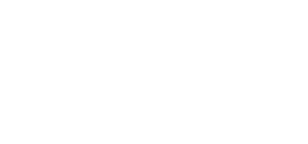Lärmbelästigung
Lärm ist mehr als nur laut – er kann stören, belasten und krank machen. Dabei unterscheidet man zwischen verschiedenen Lärmarten (kontinuierlich, intermittierend, Impulslärm), die physikalisch in Dezibel messbar sind.
Was ist Lärm?
- Lärm ist kein gewöhnlicher Schall, sondern ein ungewollter Schall, der stört, belastet oder gesundheitlich gefährden kann – im Gegensatz zu neutralen Geräuschen. Die Wahrnehmung von Lärm ist höchst subjektiv: Was dem einen kaum auffällt, kann für andere stark stören.
- Messung
Schall lässt sich physikalisch durch den Schalldruckpegel – angegeben in Dezibel (dB) – erfassen. Die Dezibelskala ist logarithmisch: Eine Änderung um 10 dB bedeutet eine etwa doppelte oder halbe empfundene Lautstärke - Typen von Lärm
Kontinuierlicher Lärm, z. B. von Maschinen wie Gebläsen
Intermittierender Lärm, z. B. Flugzeuge oder Wecker
Impulslärm, wie bei Explosionen oder Schüsse - Typische Lautstärken (Beispiele):
| Geräusch | Lautstärke (dB(A)) | Empfundene Lautstärke |
| Flüstern, ruhige Wohnstraße | 30–40 | sehr leise bis leise |
| Unterhaltung, Bürolärm | 50–60 | normal bis laut |
| Straßenlärm bei starkem Verkehr | 70–80 | laut bis sehr laut |
| laute Fabrikhalle | 90 | sehr laut |
| Autohupen in 7 m Abstand, Kettensäge in 1 m Abstand |
110 | sehr laut bis unerträglich |
| Flugzeugtriebwerk in 100 m Entfernung | ~120 | äußerst laut bis schmerzhaft |
Grenzwerte
Einheitliche Grenzwerte gibt es nicht – sie unterscheiden sich etwa nach Lärmquelle (z. B. Straße, Bahn, Industrie) und werden gemäß spezifischer Verordnungen bewertet.
Wie wirkt Lärm?
- Gezielte Gesundheitsgefahren
Lärm kann das Gehör schädigen – vom temporären Hörverlust bis hin zu permanenten Schäden und Tinnitus. Besonders gefährlich sind kurze, sehr laute Schallspitzen oder langfristige Lärmeinwirkung - Stress und physiologische Effekte
Auch niedrige, nicht gehörschädigende Lärmpegel – etwa durch Verkehr – lösen im Körper Stressreaktionen aus. Diese umfassen Aktivierung des autonomen Nervensystems, veränderten Blutdruck, Herzfrequenz sowie die Ausschüttung von Stresshormonen.
Solche Reaktionen können auch unbewusst passieren, beispielsweise im Schlaf oder bei Menschen, die glauben, sich an den Lärm gewöhnt zu haben. - Langfristige Folgen
Chronische Lärmbelastung kann zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen (z. B. Bluthochdruck, Arterienverkalkung, Herzinfarkt) und Veränderungen im Stoffwechsel (z. B. Blutwerte) führen – oft weit unterschätzt. - Gesamtgesellschaftliche Relevanz
Die gesundheitlichen Folgen von Lärm betreffen viele Menschen und verursachen erhebliche volkswirtschaftliche Schäden – daher ist politisches Handeln dringend nötig. In Baden-Württemberg wurde zudem erstmals eine koordinierende Lärmschutzbeauftragte mit Kabinettsrang eingesetzt.
Kontakte bei Lärmbelästigung
Kontakte bei Lärmbelästigung: Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg
Lärmbelästigung in der Nachbarschaft
Nachbarschaftslärm: Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg
Sommer-Lärm
Besonders im Frühling und Sommer häufen sich die Beschwerden über Lärmbelästigungen während der Nacht. Da es lange hell und warm ist, spielt sich das Leben öfter draußen ab und dauert dann oft bis in die späten Nachtstunden. Viele Leute haben die Schlafzimmerfenster wegen der Kühle in der Nacht geöffnet und nehmen dadurch den Lärm draußen viel eher wahr.
Unsere Bitte deshalb, nehmt aufeinander Rücksicht und vermeidet unnötigen Lärm!